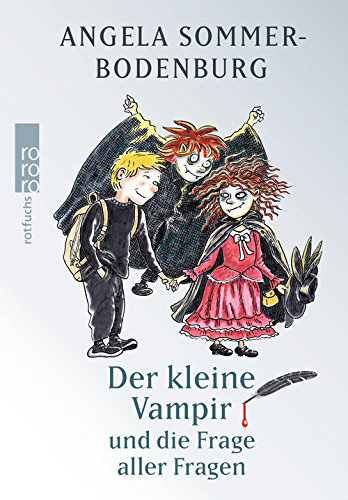
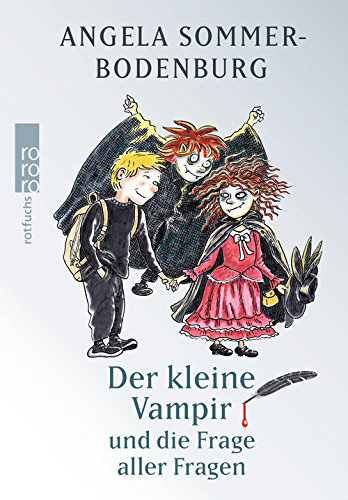
Ein durch und durch gelungenes Finale
Rezension von Andy Winkler
1979 erblickte „Der kleine Vampir“ das Licht der Bücher-Welt. Vor gut sieben Jahren erschien mit „Der kleine Vampir und die letzte Verwandlung“ der 20. und eigentlich letzte Band der Geschichten um Rüdiger von Schlotterstein, dessen Schwester Anna und ihren Menschenfreund Anton Bohnsack. Doch wie so oft im Leben kommt manches anders, als gedacht - und mit „Der kleine Vampir und die Frage aller Fragen“ das nun endgültige Finale.
In „Die letzte
Verwandlung“ wurde Anna als Nachfolgerin von Elisabeth der Naschhaften zur
„Obervampirin“; eine Stellung, die Verantwortung mit sich bringt und Zeit
beansprucht. So hat
Anton seine Vampirfreunde seit nunmehr „7 mal 7 mal 7“, also 343 Nächten
nicht mehr gesehen. Vieles hat sich während dieser Zeit in Antons Leben
verändert.
„Vor fünf Tagen hatten für Anton die Sommerferien angefangen. Doch diesmal war
alles anders. Nach einem furchtbaren Ehekrach hatten sich Antons Eltern
getrennt, und nun wohnte er abwechselnd bei seinem Vater in der alten Wohnung
und bei seiner Mutter in ihrer neuen Wohnung.“
Anton ist lustlos und weiß mit sich nichts anzufangen. Meist liegt er faul herum
und „starrt Löcher in die Luft“, wie sein Vater es ausdrückte. Doch das ändert
sich, als Anna (die sich zwischenzeitlich im rumänischen Herkulesbad aufgehalten
hatte) in Antons Zimmer landet und ihn bittet, den Sommer mit ihr zu verbringen.
Obwohl Antons Eltern auch nach all seinen Bemühungen dem nicht zustimmen,
entschließt er sich dazu, Annas Einladung trotzdem anzunehmen und sie bei der
alten Kapelle zu treffen...
Während Anton diesen Schritt unbeirrt umsetzt, stellt ihn hingegen „die Frage
alle aller Fragen“ vor eine weitaus schwierigere - und endgültige -
Entscheidung.
„Die Frage aller Fragen muss in ihrer althergebrachten, überlieferten Form
gestellt werden. Kein einziges Wort darf verändert werden.“
Dreimal kann die Frage aller Fragen gestellt werden, danach jedoch nie wieder...
Anton fühlt sich hin und her gerissen - zwischen seinen Eltern ebenso, wie auch
zwischen seinem Leben (in dem er Anna letztendlich entwachsen würde) und der
Welt der Vampire.
Aber will er selbst Vampir werden?
Anna führt ihn zur „Villa Mitternacht“, wo er Klara kennenlernt, eine junge Frau, die kein Sonnenlicht verträgt, und ihren Vater, den Professor...
Natürlich treffen wir im letzten Band - neben Rüdiger, Anna und Anton - mit Lumpi, Olga von Seifenschwein, Tante Dorothee oder Großtante Brunhilde auch auf weitere alte Bekannte. Noch dazu gelingt es Tante Dorothee und Olga, Anton zu entführen...
Und was hat es mit der „verbotene Salbe“ aus einer verschütteten Grotte in Herkulesbad auf sich, mit der Anna ein geheimnisvolles Zeichen auf Antons Stirn malt? Ein unsichtbares Zeichen, das bei Erregung sichtbar wird und leuchtet und das für Anton „Das Tor zur Welt der Vampire“ öffnet...
---
Mit 240 Seiten hat „Der kleine Vampir und die Frage aller Fragen“ erfreulicherweise rund 100 Seiten mehr, als die bisherigen Bände. Auch die edel wirkende, silbern glänzende Optik des Einbands macht die finale Ausgabe nochmals zu etwas Besonderem. Zumal diese, entgegen der bisherigen regulären Bücher, nicht als Taschenbuch, sondern gebührend als gebundene Hardcover-Edition aufgelegt wurde.
In der von ihr gewohnten Art charakterisiert Angela Sommer-Bodenburg in „Die
Frage aller Fragen“ Situationen, Orte und Stimmungen gekonnt bildhaft, wodurch
es dem Leser gelingt, in die Geschichte einzutauchen.
„Eine Villa, die größer und düsterer als die anderen war, hatte Anton besonders fasziniert. Sie stand inmitten eines verwilderten
Gartens hinter einem rostigen Eisenzaun. Efeu rankte sich bis zu ihrem Dach
hinauf, und immer waren die Holzläden vor den Fenstern geschlossen. (...) In der
Villa war es auffallend kühl und ein merkwürdiger Geruch erfüllte die Luft, eine
Mischung aus Kräuterdüften, Staub und Moder. (...) Auch das Badezimmer strahlte
eine altertümliche Eleganz aus. Die Kacheln sahen wie handbemalt aus, die
Armaturen waren vergoldet, und es duftete nach teurer Seife und Rasierwasser.“
Als Anton sich in der Bibliothek des Professors
die seidenen Handschuhe überstreift, um beim Lesen der seltenen Büchern keine
Fingerabdrücke auf den „dünnen, vom Alter vergilbten Seiten“ zu hinterlassen,
benennt Angela Sommer-Bodenburg ebenso Titel, Erscheinungsjahr und Verfasser der
antiquarischen Schriften.
Auch wenn die Trennung von Antons Eltern - eine Situation aus dem wahren Leben, in die sich viele Kinder hinein versetzen können - Bestandteil des Buches ist und Antons Gefühlslage sowie sein Verhalten in „Die Frage aller Fragen“ mitbegründen, werden die Trennungsgeschichte und deren Hintergründe nicht mehr als nötig ausgeweitet und vertieft, so dass sie die eigentliche Handlung nicht überlagern.
„Manchmal
verstehen wir unsere eigenen Wünsche nicht. Und wenn die Wünsche sich dann
melden, schrecken wir vor ihnen zurück.“ (Anna von Schlotterstein)
Früher war Anton fest entschlossen, kein Vampir zu
werden. Aber heute, nachdem er älter ist und sich sein ganzes Leben im Wandel
befindet? Zumal er seit dem Biss durch Olga von Seifenschwein und der Berührung
mit dem Schwert Mjerkur in „Der kleine Vampir und die letzte Verwandlung“ bei
der Benutzung von elektrischen Geräten, wie Handys oder Computern, Kopfschmerzen
bekommt?
„Ich war ja schon immer etwas anders als die anderen. Aber jetzt bin ich der
totale Außenseiter.“
Wie wird Anton sich entscheiden - immerhin mit dem Wissen, dass diese
Entscheidung endgültig sein wird?
Fazit:
Meine Neugierde, wie es ausgehen würde, war sehr groß und je mehr sich die
Geschichte dem Ende näherte, umso ungeduldiger wurde ich. Ich musste mich
regelrecht zwingen, in Ruhe weiter zu lesen.
Mit Band 21, Der kleine Vampir und die Frage aller Fragen, endet die Buchreihe
nach nunmehr 36 Jahren mit einem überaus gelungenen und würdigen Finale.
Ein Muss für jeden Fan und Liebhaber des kleinen Vampirs, der gemeinsam mit den
Charakteren älter geworden ist und nach dem offenen Ende von Band 20 stets das
Gefühl hatte, dass hier „noch etwas zum Abschluss fehlt“.
Wieder passend und liebevoll von Amelie Glienke illustriert sowie mit stimmiger
Handlung und kleinen Rückblicken auf vergangene Ereignisse, gehört das Buch
inhaltlich und mit diesem Finale für mich persönlich mit zu den besten Bänden
des kleinen Vampirs.
Andy Winkler, www.Gruft-der-Vampire.de
20 Bände lang zeichnete sich Angela Sommer-Bodenburgs Reihe Der kleine Vampir vor allem durch eines aus: Verlässlichkeit. Weder gab es große Veränderungen im Personal noch alterte dieses merklich oder fanden die gesellschaftlichen, technischen und medialen Veränderungen zwischen 1979 und 2008 einen spürbaren Wiederhall in den Romanen. Ein Großteil des Erfolges beim mitgewachsenen Publikum mehrerer Kindheitsgenerationen dürfte darin begründet liegen: In der konservierten heilen Mietwohnungsweltordnung der 1980er-Jahre, deren sonstige literarische wie filmische Repräsentationen inzwischen längst das Zeitliche gesegnet haben und allenfalls in nostalgischen Rückblicken für einen Moment wiederkehren. Auch die nahezu unveränderte Erzählweise Sommer-Bodenburgs, die im Unterschied zu J.K. Rowling und Harry Potter bislang weder an Umfang noch an Drastik je zugelegt hatte, trug zur verlässlichen Wiederkehr des 20-mal Ähnlichen bei.
Angesichts dieser Ausgangslage ist es eine äußerst mutige Entscheidung, aus dem selbstangelegten Korsett auszubrechen, was bereits der fast doppelte Umfang von 232 Druckseiten andeutet. Und auch die Brüche, die den neuen Band leitmotivisch durchziehen, hätten kaum radikaler inszeniert werden können. Bereits die erste Szene eröffnet mit gleich mehreren Überraschungen: Antons Eltern, deren Abneigung gegen Vampire stets die Grundspannung der Romane ausgemacht hatte, haben sich getrennt – und die vormalige Kleinfamilien-Idylle, deren Enge Anton immer wieder mit Büchern und nächtlichen Abenteuern zu entfliehen suchte, ist zerbrochen. Während die Mutter bereits ausgezogen ist und mit ihrem neuen Freund Urlaub macht, verbringt Anton seine Ferien beim in der gemeinsamen Wohnung zurückgebliebenen Vater, der lange arbeitet und daheim einen trostlosen Jogginghosen-Lifestyle zwischen Sofa, Fernseher und Mikrowellenessen pflegt. Anton, ansonsten besonders oft zu Romanbeginn als eifriger Leser gezeigt, starrt zum 21. Auftakt lediglich traumatisiert vom Bett aus an die Decke – und wartet.
Dieser statischen Exposition sind noch weitere gravierende Veränderungen eingeschrieben. Denn seit dem Biss durch Olga im 20. Band, der an Anton zwar nicht die im Titel attribuierte ‚letzte Verwandlung‘ vollzogen hat, ist er dennoch Vampir-ähnlicher geworden, was sich gerade in alltäglichen Situationen für Anton nachteilig äußert. Sein Handy fasst er aufgrund einer Unverträglichkeit nur wiederwillig an und im Gegensatz zum Rest seiner Schulklasse benutzt er im Unterricht kein Tablet. – Was sich als trivialer Befund leicht überlesen ließe, ist nichts anderes als eine Revolution der erzählten Welt vom ‚kleinen Vampir‘, in der es mit Buch, Fernseher und Kassettenrecorder des Ausgangsjahres 1979 keine medialen Anpassungen gegeben hatte. Somit ist bereits hierin die große Veränderung beschrieben, die Anton seiner alten Welt halb entrückt und einem neuen Zwischenzustand zugeführt hat, den zu meistern ihm anfangs nicht gelingt. Dies zu lesen, ist nach den Jahrzehnten der Fortschrittsresistenz irritierend. Aber überaus folgerichtig, wenn es Sommer-Bodenburg ernst meint mit dem Ende der Reihe.
Nach 343 einsamen Nächten erhält Anton neuerliche Besuche der Vampire Anna und Rüdiger. Er entflieht seinem Elternhaus indem er vorgibt, mit Annas Familie in den Urlaub zu fahren, stattdessen aber mit Anna in der Villa eines befreundeten Professors und dessen Tochter wohnt. Hier ist es dem erhöhten Umfang des Bandes zu verdanken, dass mehr Raum für Beschreibungen, Namen und Details ist. Auch wenn sich die Reihe seit jeher durch vielzählige Verweise und Anspielungen auf Klassiker der phantastischen Literatur auszeichnete, findet dieses Motiv in der Bibliothek des Professors, die eine eigene vampyrologische Sammlung beinhaltet, seine Vollendung. Auch, weil diese Antons altes Interesse an Literatur wiedererweckt.
Ohne Spoiler ist der weitere Verlauf kaum zu besprechen, denn alles läuft auf die entscheidende Frage zu – ob Anton zum gemeinsamen ewigen Leben mit seinen Vampirfreunden übergehen oder Mensch bleiben wird. Die Antizipation der möglichen Enden – Anton willigt ein und wird ebenfalls zum Vampir, oder er verneint und verprellt Anna und Rüdiger dadurch – stehen im Mittelpunkt von Antons Denken. In der Reflexion seiner Möglichkeiten, die sich bereits in früheren Büchern findet, ist Anton jedoch zunehmend konservativer und, paradoxerweise, daher für die letzte Verwandlung stetig empfänglicher geworden. Ins alte Leben zurückzumüssen, erscheint nunmehr als Horrorvision, weil er die durch die neuen Beziehungspartner seiner Eltern und Geschwister angedeuteten Veränderungen seines gewohnten Alltags fürchtet. Demgegenüber gewinnt die Ewigkeit einer garantierten Veränderungslosigkeit in guter Gesellschaft seiner Vampirfreunde an Attraktivität.
Den alles verändernden, revolutionierenden Schritt zu wählen, um den ewigen Gleichlauf der Fortexistenz dadurch zu sichern, der erst durch die gravierende Erfahrung der Trennung seiner Eltern eingeleitet wurde, ist gleichbedeutend für den Zusammenbruch einer alten, heilen Welt – aus deren traurigen Resten sich Anton zu erretten sucht.
Das Leben mit den Vampiren hatte immer etwas Traumhaftes. Ohne das Wissen(-wollen) seiner Eltern führte Anton von Anfang an ein eigenes, der Alltagswelt abgewandtes zweites Leben, dessen Dunkelheit wiederholt als große Verheißung eines Erwachens angeklungen war. Die dazu notwendige Frage aller Fragen, ein zentrales Motiv zwischen Anton und den Vampiren, wird auf dem Weg zum „Finale“ noch dreimal gestellt. Antons Antwort indessen lässt ein endgültiges Ende der Reihe ebenso plausibel scheinen wie einen ganz neuen Anfang.
Niels Penke, www.literaturkritik.de